Viele Menschen denken bei KI erst mal an Software – an etwas, was sie mit einer einfachen Oberfläche nutzen können, das programmiert wurde, nach klaren, durchdachten Regeln funktioniert – man muss es einfach nur lernen und dann ist es kontrollierbar. Dieses Bild wirkt vertraut , weil es uns ja auch das Gefühl von Kontrolle gibt. Und es scheint auf den ersten Blick zu stimmen: KI-Tools wie ChatGPT oder Microsoft Copilot fühlen sich oft erstaunlich einfach an: Kurzer Prompt – tolle Antworten, längerer Prompt – bessere Antwort. Und das wirkt vertraut und beruhigend. Aber genau dieses Bild ist der Haken: Denn es kann uns dazu verleiten, der KI zu viel zuzutrauen – und dabei das eigene Denken in den Hintergrund zu stellen. In diesem Artikel werfen wir gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert KI wirklich und warum lohnt es sich, das genauer zu verstehen?
Inhaltsverzeichnis
- Warum wir glauben, dass KI eine “besondere Software” ist
- Von KI-Mythen, -Halbwahrheiten und KI-Wunschdenken.
- Die Vorstellungen über KI sind nicht nur Illusionen, sondern sogar ein bewiesener Bias
- Illusion of Control:
- Warum KI nicht funktioniert wie klassische Software – fünf entscheidende Unterschiede
- Warum das “glauben aller Antworten” gefährlich wird – in der Praxis und im Denken
- Warum kritisches Denken auch in der KI-Zeit unverzichtbar bleibt
- Checkliste: Wie Du mit KI-Antworten im Alltag klug umgehst
- Praxisimpuls: So nutzt Du KI als echten Sparringspartner – nicht als Glücksmaschine
- Fazit
- Author
Warum wir glauben, dass KI eine “besondere Software” ist
Die Vorstellung, dass KI eine irgendwie neue und andere Form von Software ist, kommt nicht von ungefähr. Sie ist tief in unserem Erfahrungswissen verankert, vor allem bei denjenigen, die mit digitalen Tools, Datenbanken oder Automatisierung im Berufsalltag groß geworden sind. Jahrzehntelang wurde uns beigebracht: Software basiert auf klaren Regeln. Wenn man ein Programm beherrscht, kennt man die Abläufe, kann Funktionen gezielt nutzen und das Ergebnis zuverlässig wiederholen. Excel ist ein gutes Beispiel dafür – ein Werkzeug, das uns lehrt: Wenn ich Formeln sauber strukturiere, passiert exakt das, was ich vorgebe: Nichts, was ich mit Excel tue, ist ein Zufall oder entwickelt gar ein Eigenleben und ich behalte die Kontrolle: Ich muss es nur verstehen, dann klappt das schon mit dem Tool. Und so denken viele bei KI – und das ist leider für echten Erfolg eine Sackgasse und führt in die Irre.
Von KI-Mythen, -Halbwahrheiten und KI-Wunschdenken.
Auch die Art, wie über diese Technologie gesprochen wird, prägt unser Bild weiter – kaum einer außerhalb der Tech-Welt stellt sich der Wahrheit: In Medienberichten, Visualisierungen oder natürlich besonders in Science-Fiction-Filmen wird KI mit Robotern, Formeln, Algorithmen und metallischen Köpfen gleichgesetzt, als logisch durchstrukturierte Intelligenz, die Dinge berechnet, ausführt und sich an vorgegebene Abläufe hält.
Es wird viel versprochen und nur wenig gehalten (Besonders zu nennen ist hier das bekannte Fake-Beispiel des Roboters “Optimus” von Tesla der Ende 2024 bei der Einführungsshow Menschen in die Roboter-Rüstung steckte, und behauptete weil es seien Prototypen. (Hier mehr).
Dennoch, viele Menschen wollen es glauben, weil es sich rational und berechenbar anfühlt, wie eine neue, wünschenswerte Realität: Wir erwarten (oft im Grunde unbewusst ), dass KI nun bald so ist wie in Filmen wie “Terminator” oder “i-Robot”, das ist unser aufgebautes Wunschdenken. Aber das ist Werbung, Marketing und eine Scheinwelt und wir sind weit davon entfernt, weiter als die meisten denken.
Und wenn wir etwas nicht verstehen, versuchen wir es zu simplifizieren: Denn immerhin, wenn ich KI selbst „füttere“, bediene oder konfiguriere, dann haben ich das Gefühl, die Kontrolle über die KI zu behalten. Ich schreiben etwas hinein, also kommt etwas heraus – und das ist im Idealfall auch fast genau das sein, was wir erwarten. Es ist so einfach wie Google – also beherrsche ich das System. Wir haben gelernt, dass dieses mentale Modell in klassischen Softwaresystemen ziemlich gut funktioniert. So erwarten wir, dass KI sich dauerhaft auch so verhält, weil sie sie teils an der Oberfläche so effizient, logisch und verlässlich “anfühlt” bzw. besser formuliert: Weil wir sie alle so wahrnehmen und so erklären. Aber die Wiederholung einer unwahren Fakten, machen sie nicht wahr.
Die Vorstellungen über KI sind nicht nur Illusionen, sondern sogar ein bewiesener Bias
Unsere Vorstellung, wie Technik zu funktionieren hat und in unser bisheriges Weltbild passt, übertragen wir heute ganz oder in Teilen auf KI-Systeme. Und genau hier beginnt die Schwierigkeit: Denn moderne KI bricht mit dieser Logik. Sie funktioniert komplett anders, und die Technikwelt weiß dies und handelt danach (und geht komplett anders mit KI um). Aber unsere Business- und Alltagswelt bedient sich weiter dem alten Denken und Hoffen, was bei kleinen Aufgaben und kurzen Prompts an die KI kein Thema ist, weil kein großen Erwartungen dahinter stehen. Aber es wird dann absurd, wenn behauptet wird, dass angeblich ein einziger kurzer Prompt ganze Qualitäts-Prozesse in KI anstossen konnte.
Denn die Wahrheit ist, dass ohne spezielle und fundierte technische Maßnahmen, die aktuellen KIs mal gute Ergebnisse zeigen und dann wieder mit Qualitätsinkonsistenz in Form von vagen Antworten oder Halluzination die User in Atem halten. Das es ein Fakt ist, dass KI definitiv technisch und auch in der Usage anders ist als Software und dieses System nicht linear arbeitet, müssen wir bei denjenigen, die eine andere Funktionsweise erwarten über hier über die falsche Wahrnehmung sprechen.
Warum ist das so, das Menschen trotz der objektiven Ergebnisse weiter annehmen und nicht in Frage stellen? Wenn Menschen denken, dass sie mit eine paar einfachen Prompts KI selbst „füttern“, bedienen oder konfigurieren können, dann annehmen, dass sie so “einfach” die Kontrolle über die KI behalten, dann sprechen wir vom Kontrollillusion-Bias (auch Illusion of Control genannt).
Illusion of Control:
Der psychologische Effekt, dass Menschen glauben, mehr Einfluss auf ein System zu haben, nur weil sie daran mitwirken oder es bedienen können – selbst wenn sie objektiv keinen echten Einfluss auf das Ergebnis haben.
Belegt z. B. durch:
-
Heute vielfach erforscht, auch im Zusammenhang mit Interfaces, Automatisierung und KI – besonders schön beschrieben im Buch:
Warum KI nicht funktioniert wie klassische Software – fünf entscheidende Unterschiede
Tatsächlich ist der Unterschied von KI und Software begründet in der technischen Struktur. Damit die Unterschiede für Dich – ohne technischen Tiefgang – wirklich greifbar werden, hier fünf der zentralen Punkte und Auswirkungen dieser komplett anderen technischen Struktur von KI im Vergleich zu Software, die deutlich machen, warum KI eben nicht wie ein klassisches Programm arbeitet:
1. KI „entscheidet“ nicht nach Regeln, sondern „vervollständigt“ nach Wahrscheinlichkeiten.
Ein KI-Modell wie ChatGPT wurde trainiert, um vorherzusagen, welches Wort am wahrscheinlichsten als Nächstes passt – nicht, um objektiv richtige Antworten zu liefern. Es folgt dabei keinem festen Wenn-Dann-Plan, sondern einer Art statistischem Sprachgefühl. Sie berechnet die nächste wahrscheinliche Silbe oder das nächste Wort für eine Antwort. Damit erreicht ein solches Modell im Schnitt nur 60% bezogen auf die mathematische Richtigkeit einer Antwort.
2. Der große Denkfehler: Man erwartet Wahrheit – bekommt aber nur Plausibilität.
KI wirkt überzeugend, aber sie kennt keine Fakten im klassischen Sinn. Sie rechnet nur, was wahrscheinlich klingt – nicht, was belegbar richtig ist. Sie versteht nicht, das heißt sie setzt nur Worte hinter Worte und das so, dass der User sich “wohlfühlen soll”, die Antwort “glaubt” – also in einer Sprache, die teils mehrere Deutungen zu lässt und dem User Recht gibt ” Das ist eine besonders kluge Frage!” oder ihn sogar in seinem Ton spiegelt.
3. Was gut formuliert ist, wird schnell als korrekt wahrgenommen.
Unser Gehirn liebt Klarheit. Und wenn die KI flüssig schreibt, in ganzen Sätzen argumentiert und sogar empathisch klingt, schalten viele das kritische Denken ab – obwohl sie es gerade jetzt bräuchten. KI nutzt dazu besondere Sprach-Effekte, die schon das Oracle von Delphi kannte: Den Barnum- oder Forer-Effekt . Diesen Effekt nutzen nicht nur Wahrsager, sondern besonders die Werbeindustrie (hier mehr): Menschen neigen dazu allgemeingültige Aussagen in Zusammenhang mit sich selbst als erstaunlich genau und individuell zu empfinden. Hier ein Konversationsbeispiel mit der ChatGPT- Antwort KI: “Diese Wahl passt einzigartig zu Dir.” Warum? “Du handelst gern entschlossen, bist aber auch häufig unsicher, wie Du Dich verhalten sollst.” (gleich zwei Mal eine Barnum-Aussage).
4. People-Pleasing ist ein weiterer Teil der Sprachstrategie der KI.
KI, besonders ChatGPT und Claude, aber nun auch Copilot und Grok, wurden so trainiert, dass ihre Antworten verständlich, freundlich und hilfreich wirken. Das ist gut – denn es fördert Kooperation und Vertrauen. Aber es kann auch dazu führen, dass wir uns zu sicher fühlen – und die KI für uns denken lassen. (Hier mehr zu ChatGPT und warum Sam Altman es gut findet, das ChatGPT “people-pleasing” ist)
5. Deshalb bleibt das kritische Denken unsere wichtigste Aufgabe.
Eine gute KI ist ein wertvoller Begleiter – ein AI-Companion, der uns unterstützt, inspiriert, ergänzt. Aber sie ist nicht perfekt. Und je besser wir mit ihr im Dialog bleiben – hinterfragen, klären, bewusst steuern – desto mehr Nutzen ziehen wir daraus. Wir trainieren KI durch unsere Fragen in unserem Sinne zu antworten und können so die Qualität der Antworten steigern, wenn wir diese klug hinterfragen und nicht einfach “glauben”.
Warum das “glauben aller Antworten” gefährlich wird – in der Praxis und im Denken
Wenn wir KI nutzen, ohne zu verstehen, wie sie funktioniert, entsteht ein trügerisches Gefühl von Sicherheit. Die Antworten wirken durch ihre sprachliche Präzision oft so stimmig, dass wir nicht merken, wenn etwas fehlt – oder schlicht nicht stimmt. Im Alltag kann das dazu führen, dass wir fehlerhafte Informationen übernehmen, konkret sogar ganze Situationen oder schlimmer: Ergebnisse falsch einschätzen, ungenaue Zusammenfassungen übernehmen oder Argumentationen weitertragen, die auf falschen Annahmen beruhen. Am Ende treffen wir falsche Entscheidungen und merken es nicht.
Viel entscheidender ist aber etwas anderes: Wer sich zu sehr auf die äußere Sicherheit der KI verlässt, beginnt, das eigene Denken schrittweise zurückzunehmen.
Kritische Rückfragen werden seltener. Wir neigen dazu, zu glauben, was gut klingt. Und wir überlassen KI allmählich die Rolle, die eigentlich uns zusteht – die des bewussten, reflektierenden Menschen im Raum. Es beginnt also mit dem Vermenschlichen von KI und endet mit Problemen, Enttäuschungen oder tatsächlich richtigen Fehlern.
Das Problem ist also: Wir sehen in solchen Fällen dann – aufgrund unserer falschen Einschätzungen und Erwartungen – die wahren Stärken von KI dann nicht.
Und wenn etwas schief geht, und wir dann nicht realistisch sind (oder sogar schon die Reflektion bzw. das Kritische Denken nicht mehr konsequent nutzen), können wir daraus nicht lernen und unsere Verhalten nicht ändern, wenn wir es nicht klar sehen und die Wahrheit akzeptieren wollen. Die Konsequenz ist: Wir suchen nach weiteren Bestätigungen unseres Denkens und Handelns und setzen die Probleme fort oder verstärken sie sogar.
Das bedeutet nicht, dass wir KI nicht nutzen sollten. Im Gegenteil. Aber es bedeutet, dass wir lernen müssen, bewusster mit ihr zu arbeiten – nicht als Ersatz für unser Denken, sondern als Impulsgeber, Sparringspartner, Perspektivöffner. Genau darin liegt ihr größter Wert.
Warum kritisches Denken auch in der KI-Zeit unverzichtbar bleibt
KI kann uns viel Arbeit abnehmen – aber sie ersetzt nicht unser Urteilsvermögen. Sie liefert Vorschläge, Texte oder Analysen, die oft gut klingen und hilfreich wirken. Doch genau darin liegt die Herausforderung: Wenn wir die Ergebnisse einfach übernehmen, ohne sie einzuordnen, wird aus Unterstützung schnell Abhängigkeit. Was hilft, ist kein Misstrauen – sondern wacher, reflektierter Umgang mit jeder Antwort.
Denn KI-Antworten wirken oft durch ihre Sprache überzeugend – auch dann, wenn sie fachlich unscharf, veraltet oder inhaltlich lückenhaft sind. Wer die Antworten nur nutzt, läuft Gefahr, ihnen mehr Bedeutung zu geben, als sie tragen können. Wer sie aber einordnet, macht aus der KI einen echten Partner.
Checkliste: Wie Du mit KI-Antworten im Alltag klug umgehst
1. Frage Dich: Will ich eine Idee – oder eine exakte Auskunft?
KI ist stark im Entwurf, in der Inspiration und in der Strukturhilfe. Für rechtlich verbindliche Aussagen, medizinische Infos oder Entscheidungen mit hoher Tragweite brauchst Du zusätzliche Quellen.
2. Prüfe den Inhalt, nicht nur die Form.
Eine gut klingende Antwort kann trotzdem falsch oder zu allgemein sein. Hinterfrage Zahlen, Behauptungen oder Definitionen. Lass Dir Begriffe erklären – auch mehrfach.
3. Nutze die KI im Dialog, nicht als Einweg-Antwortgeber.
Frag nach: „Warum hast Du das so formuliert?“ oder „Was könnte dagegen sprechen?“ – Das schärft die Qualität der Antwort und zeigt Dir auch mögliche Lücken.
4. Formuliere Deine eigenen Gedanken danach aktiv um.
Nutze die Antwort als Impuls, nicht als fertige Lösung. Schreib es so um, dass es Deine Sprache, Dein Denken, Deine Verantwortung trägt.
5. Erkenne den Stil: Will die KI Dir gefallen – oder Dir helfen?
Wenn alles übertrieben positiv, weich oder gefällig klingt: Frag nach einer neutraleren, differenzierteren Version. Ändere die Anfrage: Du bestimmst die Haltung – nicht das Modell.
Praxisimpuls: So nutzt Du KI als echten Sparringspartner – nicht als Glücksmaschine
KI-Erfolg kommt nur von Tiefe: “Verstehen wie KI funktioniert” allein reicht nicht für Deinen Erfolg, weil echte Wirkung erst entsteht, wenn wir unser Verhalten anpassen. Zwar brauchst Du, wenn Du Fehler vermeiden und aus der KI mehr herausholen willst keine technischen Vorkenntnisse und musst auch nicht einen Zusatzkurs in “kritisches Denken” belegen.
Was Du brauchst ist
- Klarheit über die Funktionsweisen Deiner Tools,
- Struktur in Deinen Anfragen,
- bodenständige Erwartungen und Realismus,
- die Bereitschaft zu Lernen und
- ein paar gezielte Gewohnheiten beim Prompten.
Kurz: Du brauchst eine neue Routine, die anders ist, als alles was Du bisher gelernt hast. Und dabei gibt es eine wichtige und gute Nachricht:
KI lässt sich führen und unterstützt Dich dabei, Deine gewünschten Qualitäts-Ergebnissen zu erreichen.
Nur ist eben Qualität und Effektivität nicht mit so einfach in der Praxis auf Dauer umzusetzen, wie Dir der eine oder andere “Schein-Experte” mit seinem Halbwissen und Mythen weiß machen will, sondern nur mit Tiefe und Nachhaltigkeit.
Fazit
In Wahrheit geht es nicht um “Kontrolle” von KI, sondern um Zusammenarbeit mit einem ungeheuer hilfreichen Tool-System, das man durch den richtigen Kontext, mit Sprache und Haltung steuern kann – aber das in Wahrheit noch keine eigene Intelligenz hat.
KI ist also kein magisches Tool oder gar eine “klassische Software”, sondern ein auf Sprache basierendes System, dessen Antworten auf Wahrscheinlichkeitsrechnungen basieren. Diese Wahrscheinlichkeiten sind gut, aber erreichen ohne konsequente zusätzliche Qualitätskontrollen und spezielle Maßnahmen nie 100 %.
Wer das versteht, kann gezielt mit KI arbeiten, wird bessere bis richtig gute Antworten erhalten und kann das eigene Denken bewusst einbringen. Es geht nicht darum, der KI blind zu vertrauen, sondern darum, KI als Partner und Assistenzsystem zu führen und zu nutzen. Klarheit, Kontext und kritisches Mitdenken bleiben dabei unser wichtigstes Werkzeug. Denn die Qualität der KI hängt oft weniger von ihr ab und ihrer Struktur ab, sondern von uns und unseren Anweisungen, Entscheidungen und Handlungen.
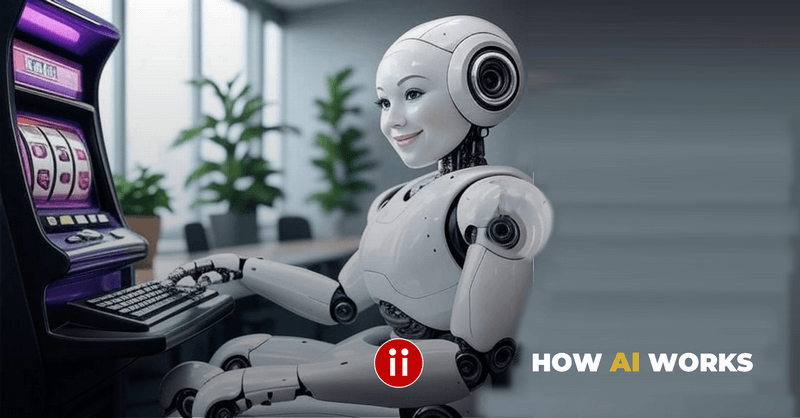



Hinterlassen Sie einen Kommentar